Mit dem Beginn des neuen Schuljahrs in Baden-Württemberg kehrt nicht nur der Alltag in Klassenzimmer und Schulhöfe zurück, sondern auch die Diskussion um den Bildungsstand der Schülerinnen und Schüler im Südwesten. Einst als Vorreiter unter den Bundesländern gefeiert, steht Baden-Württemberg zunehmend in der Kritik: Die Leistungen der Schüler*innen liegen in einigen Fächern nur noch im Mittelfeld – mit bedenklichen Tendenzen.
Bildungsland mit Kratzer im Lack
Lange galt Baden-Württemberg als eine der bildungsstärksten Regionen Deutschlands. Ein stabiles Schulsystem, gute Lehrerbildung und ein hoher Leistungsanspruch galten als Markenzeichen. Doch aktuelle Studien wie der IQB-Bildungstrend zeichnen ein anderes Bild. Insbesondere in den Kernfächern zeigen sich teils deutliche Leistungseinbußen. Im Vergleich zu Bundesländern wie Bayern oder Sachsen verlieren die Schüler*innen aus Baden-Württemberg in wichtigen Kompetenzbereichen an Boden.
Deutsch: Nur durchschnittlich
Besonders im Fach Deutsch, lange Zeit eine Stärke des Südwestens, rutschen die Ergebnisse ab. In der letzten Erhebung erreichte nur noch gut die Hälfte der Viertklässler die Regelstandards im Lesen und im Zuhören – deutlich weniger als in Sachsen oder Thüringen. Auch in der Sekundarstufe zeigen sich Schwächen: Grammatik, Textverständnis und Rechtschreibung bereiten vielen Schülerinnen und Schülern Schwierigkeiten. Lehrer berichten vermehrt von sprachlichen Defiziten, die sich bereits in den unteren Klassen bemerkbar machen – oft unabhängig vom Bildungshintergrund der Eltern.
Mathematik: Sorgenkind trotz Frühförderung
Am deutlichsten ist der Leistungsabfall allerdings im Fach Mathematik. Hier schnitten baden-württembergische Schüler in Vergleichsstudien zum Teil deutlich schlechter ab als Gleichaltrige in anderen Bundesländern. Nur ein Drittel der Neuntklässler erreichte zuletzt den sogenannten Regelstandard. Besonders alarmierend: Die Zahl derjenigen, die weit unter dem Mindeststandard bleiben, steigt.
Diese Entwicklung schlägt sich auch im privaten Lernverhalten nieder. Laut einer Studie der Berstelsmann-Stiftung nehmen in Deutschland etwa 14 Prozent der Schüler*innen Nachhilfe. Mathe Nachhilfe ist dabei am häufigsten, gefolgt von den Fremdsprachen – insbesondere Englisch. Das zeigt: Der Unterstützungsbedarf ist enorm. Trotz zahlreicher Fördermaßnahmen, wie zusätzlichem Matheunterricht in der Unterstufe oder digitalen Lernhilfen, gelingt es vielen Schulen nicht, die Grundlagen nachhaltig zu vermitteln.
Naturwissenschaften und Englisch: Lichtblicke im Stundenplan
Ein positiveres Bild zeigt sich in den naturwissenschaftlichen Fächern. Besonders in Biologie und Chemie schneiden Schüler*innen aus Baden-Württemberg im Bundesvergleich solide ab. Hier profitieren sie offenbar von einer besseren Ausstattung der Schulen mit Fachräumen und Labormaterialien – ein Vorteil, den nicht alle Bundesländer gleichermaßen bieten können.
Auch das Fach Englisch entwickelt sich erfreulich: In der Mittelstufe erreichen viele Schüler*innen mindestens den angestrebten Kompetenzstandard, und die mündliche Ausdrucksfähigkeit hat sich in den vergangenen Jahren spürbar verbessert. Gründe dafür sehen Experten in der frühen Fremdsprachenförderung, die in Baden-Württemberg schon in der Grundschule einsetzt, sowie in der wachsenden Bedeutung der Sprache im Alltag und in sozialen Medien.
Bildungserfolg hängt stark vom Elternhaus ab
Ein zentrales Problem bleibt jedoch bestehen: die starke Kopplung von Bildungserfolg und sozialer Herkunft. Kinder aus bildungsnahen Familien erzielen in Baden-Württemberg nach wie vor deutlich bessere Leistungen als solche aus sozial benachteiligten Haushalten. Besonders an Haupt- und Werkrealschulen sammeln sich nach wie vor Schüler*innen mit erhöhtem Förderbedarf, während das Gymnasium eine weitgehend homogene Schülerschaft aufweist. Die Durchlässigkeit des Systems – lange Zeit ein Aushängeschild – ist ins Stocken geraten.
Was braucht es für echten Fortschritt?
Fachleute und Bildungspolitiker sind sich einig: Um das Niveau langfristig zu sichern, braucht es mehr als kurzfristige Förderprogramme. Entscheidend seien gut ausgebildete und motivierte Lehrkräfte, kleinere Klassen, gezielte Sprachförderung in der Grundschule – und nicht zuletzt eine kontinuierliche Evaluation der Lehrpläne.
Die Landesregierung hat für das neue Schuljahr zusätzliche Stellen geschaffen und das Budget für individuelle Förderung erhöht. Doch die Herausforderungen bleiben groß. Neben dem Fachkräftemangel, besonders in den Naturwissenschaften und in Grundschulen, sorgen auch Digitalisierungslücken und ungleiche Chancenverteilung für Spannungen im System.
Fazit: Zwischen Anspruch und Realität
Baden-Württemberg steht am Beginn eines neuen Schuljahrs vor alten Herausforderungen. Während einzelne Fächer wie Englisch oder Biologie Hoffnung machen, offenbaren Mathematik und Deutsch gravierende Schwächen – trotz intensiver Fördermaßnahmen und wachsender Nachhilfebranche. Der Bildungsstand der Schüler*innen hängt weiterhin stark vom Elternhaus ab, und die Unterschiede zwischen Stadt und Land, Gymnasium und Hauptschule verschärfen sich.
Der Wille zur Veränderung ist da – doch der Weg zurück zur einstigen Bildungsstärke erfordert mehr als gute Vorsätze: Es braucht ein mutiges, langfristig angelegtes Umdenken im gesamten Bildungssystem.
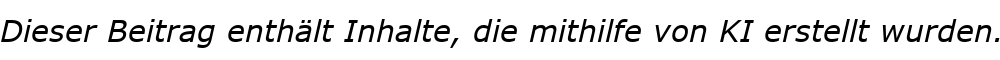
Auch interessant:

