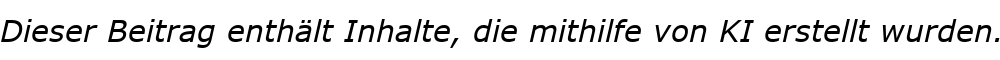Der Name einer britischen Umweltaktivistengruppe bringt es auf den Punkt: „Just Stop Oil“. Sinngemäß übersetzt: „Einfach die fossile Brennstoffnutzung beenden“. Falsch ist die Bezeichnung keineswegs. Diese einzelne Handlung hätte in der Tat extrem positive Auswirkungen auf den Klimawandel. Fossile Brennstoffe sind die Hauptursache für den menschgemachten CO2-Eintrag in die Atmosphäre.
Gerade in unserer Region sollte die Aufmerksamkeit für solche Forderungen groß sein. Als eine der sonnigsten und wärmsten Ecken Deutschlands sind wir vom Klimawandel durch Hitzesommer, Extremwetterereignisse und austrocknende Flussbetten besonders betroffen – und werden es künftig noch mehr sein.
Stellt sich die berechtigte Frage: Warum ist es derart aufwändig, schwierig, und langwierig, „die Bremse zu ziehen“? Zumal längst erwiesen ist, dass der Kampf gegen den Klimawandel bei allen Kosten erheblich günstiger ist als ein Leben mit seinen Folgen. So viel sei bereits verraten – es gibt mehrere Gründe und alle sind gewichtig.
1. Viele Staaten und eigene Interessen
Freiburg Anpassungsstrategie an den Klimawandel ist anders als etwa die von Hamburg. Baden-Württembergs Bestrebungen sind nicht deckungsgleich mit denen Niedersachsens. Deutschland hat eine andere Regierungsform als China. Die US-Bevölkerung denkt in der Breite anders über den Klimawandel als diejenige Norwegens.
Derartige Unterschiede sind sehr relevant. Denn als ein gänzlich globales Problem trifft der Klimawandel auf eine Erde, die in allein 195 einzelne Staaten aufgeteilt ist. Viele dieser Länder sind weiter unterteilt, oft mit stark föderalen Strukturen. Es gibt ferner
- unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mit vielfältigsten Ansichten,
- zahlreiche Staats- und Regierungsformen,
- variierende Grade der Betroffenheit durch den Klimawandel,
- ungleiche Abhängigkeiten von Industrie und fossilen Energieträgen und nicht zuletzt
- uneinheitliche Möglichkeiten zum Umstieg auf nachhaltige Optionen.
In der Folge gibt es auf dem Planeten zigtausende staatliche Einheiten und Gruppierungen, die mehr oder weniger starke Eigeninteressen verfolgen.
Für viele Experten ist dieses vielteilige „Mosaik“ der größte Hemmschuh im Kampf gegen den Klimawandel. Daran ändern bislang auch multinationale Übereinkünfte wie das Pariser Klimaabkommen nichts – zu sehen erst Anfang 2025, als die USA die Teilnahme (erneut) aufkündigten.
Zwar sind individuelle Handlungen besser als nichts. Wirklich schlagkräftig würde die Klimawandelbekämpfung aber nur durch stringentes globales Handeln. Es wäre das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass alle am selben Strang ziehen.
2. Wechselnde Regierungen
Mancher mag sich daran erinnern, wie vor der zurückliegenden Bundestagswahl debattiert wurde: Was von den Bestrebungen der scheidenden Ampel-Regierung unter einer neuen Koalition noch verbleiben würde. Erneut könnte man auch die USA und die dramatischen Unterschiede vor und nach der Wahl beispielhaft nennen.
An diesem Punkt sind Theorie und Praxis weit entfernt:
- Theorie: Angesichts der überwältigenden, multiplen Risiken durch den Klimawandel müsste der Fokus aller Wähler und Politiker auf dessen Bekämpfung liegen.
- Praxis: Unterschiedliche Interessen und Ansichten, andere drängende Probleme (Stichwort Ukraine-Krieg) und die Notwendigkeit, aus wahltaktischen Gründen möglichst „Mainstream-tauglich“ zu regieren, erschweren das Vorgehen.
In einer Demokratie besteht die einzige Lösung darin, unermüdlich zu informieren und zu überzeugen. Nur dann kann es gelingen, genügend Wähler und Politiker dazu zu bringen, die meisten anderen Dinge der Klimawandelbekämpfung unterzuordnen oder unter diesem Aspekt anzugehen.
3. Höchstkomplexes Klima
Selbst mit modernsten Methoden lässt sich das Wetter nur für wenige Tage korrekt vorhersagen. Zwar gibt es einen beträchtlichen Unterschied zwischen Wetter und Klima, dennoch lässt sich damit die Grundproblematik gut erklären.
Vor allem ist es enorm aufwändig, die regionalen klimatischen Verhältnisse mit ausreichender Sicherheit zu modellieren. Das zeigt sich sehr deutlich in urbanen Räumen, die besonders anfällig für extreme Wetterereignisse sind. Eine Methode, um anhand von Messungen sowohl die bisherige Klimaentwicklung als auch Zukunftsprognosen stellen zu können, ist der sogenannte Klimazeitstrahl. Für eine klimaorientierte Stadtplanung und -entwicklung werden jedoch zusätzliche Daten benötigt.
All das erfordert einen enormen Aufwand, entsprechende Finanzierungen und muss ebenfalls an vielen Orten weltweit erfolgen. Dieses detaillierte Vorgehen ist zwar nicht so bedeutend für die großmaßstäbliche Klimawandelbekämpfung – vom globalen Wandel weiß man mittelweile recht genau, wie er in den kommenden Jahrzehnten ablaufen wird. Die Detailtreue ist jedoch unverzichtbar für zwei andere Dinge:
- Zur Ermittlung lokaler Auswirkungen des Klimawandels und
- darauf basierender, maßgeschneiderter Anpassungsstrategien.
In Freiburg mit seiner eher aufgelockerten umgebenden Geographie bestehen beispielsweise andere Möglichkeiten und Herausforderungen als in Stuttgart. Obwohl nur 130 Kilometer entfernt, ist das Mikroklima in der Landeshauptstadt durch seine ausgeprägte Talkessellage völlig anders als bei uns.
4. Verzögerte Wirkungen
Was wir heute vom Klimawandel zu spüren bekommen, ist das Ergebnis von Handlungen, die mindestens bis zur Industrialisierung zurückreichen. Damals begann die Menschheit unter anderem, im großen Stil Kohle zu verbrennen, nicht mehr nur Holz. Ähnlich verzögert wirkt alles, was wir seit Jahrzehnten für das Klima tun.
Würde beispielsweise die kollektive Menschheit morgen den CO2-Eintrag in die Atmosphäre komplett stoppen, wären die ersten Auswirkungen erst nach Jahren spürbar, wie unter anderem aus dem IPCC-Zustandsbericht ergeht:
- 5 – 10 Jahre: Extremwetter nehmen langsamer zu
- 20 – 30 Jahre: Abtauen von Gletschern und Permafrostböden verlangsamt sich
- 100 – 1.000 Jahre: globale Temperaturen fangen allmählich zu sinken an
Eine Teilschuld daran tragen die Ozeane. Sie reagieren besonders träge auf Veränderungen. Gleichzeitig bedecken sie 71 Prozent der Erdoberfläche und sind daher ein sehr wichtiger Hebel der Klimasteuerung.
Solche Zeiträume sind für den Menschen problematisch. Zwar gehören wir zu den wenigen Lebewesen, die sehr umfassend vorausschauend denken und handeln können. Dennoch hängt dabei vieles von Motivatoren ab.
Der fortschreitende Klimawandel und die Auswirkungen der Gegenmaßnahmen sind für viele schlicht zu langsam, zu wenig spürbar. In der Folge reduziert sich das Bewusstsein über die erwiesenen Gefahren. Es entsteht ferner der Eindruck, die bisherigen Anstrengungen hätten keine Auswirkungen.
Das kann bei vielen eine bedenkliche Spirale antreiben. Eine, die den Klimawandel als weniger gefährlich oder ein Zukunftsproblem ansieht und daher nicht genug motiviert ist, um zeitnah zu handeln – oder entsprechende Politiker zu wählen.
5. Langwieriger, teurer Strukturwandel
Kurz nach ihrem Amtsantritt 2005 sprach Kanzlerin Merkel einen Satz, der in die Geschichte einging:
„Regenerative Energien wie Sonne, Wasser oder Wind können auch
langfristig nicht mehr als 4 Prozent unseres Strombedarfs decken.“
19 Jahre später, 2024, überschritt Deutschland diese Prognose um das 15-Fache. Auf das Gesamtjahr bezogen wurden 59,4 Prozent des Stromes regenerativ erzeugt. Beim Bruttostromverbrauch belief sich der Wert auf 54 Prozent.
Allein diese Zahlen sind ein nachdrücklicher Beweis, was möglich ist – und wie sehr das Denken von Politikern den Kampf gegen den Klimawandel hemmen kann. Doch so erfreulich der Wert sein mag, ist er dennoch das Ergebnis von
- fast einem Vierteljahrhundert Zeit. 2000 wurde das erste Erneuerbare-Energien-Gesetz verabschiedet.
- einigen Hundert Milliarden Euro Investitionen für die Errichtung der Infrastruktur, angepasster Stromnetze etc.
Und das nur in Deutschland. Eine Nation mit geringer Fläche und nicht sonderlich großer Bevölkerung. Bis heute gibt es immer noch laute Stimmen, die diesen Wandel kritisieren. Erneut haben wir es mit einem multiplen Problem zu tun: Hohe Investitionen, viele zu verändernde Aspekte, umfangreiche Planung, langwierige Umsetzung.
Die Langwierigkeit und Umfang des erforderlichen Strukturwandels sorgen für weitere Schwierigkeiten, weil darüber der Wille schwächer werden kann. Dabei spielt auch eine weitere Tatsache eine Rolle:
6. Machtvolle Lobbygruppen
Allein in den ersten drei Monaten 2024 erwirtschaftete Saudi-Arabien Einnahmen von umgerechnet 48,5 Milliarden US-Dollar mit dem Erdölverkauf. 2022 beliefen sich die weltweiten Energieausgaben auf unglaubliche 10 Billionen Dollar – etwa die Hälfte davon allein für Erdöl und -gas. Zum Vergleich: 5 Billionen entspricht etwa dem, was die Bundesregierung in zehn Jahren an Haushaltsgeldern zur Verfügung hat.
Das sind lediglich einige wenige Einnahmequellen der „fossilen Industrie“. Hinzu kommen unter anderem Kohle, Kunststoffe und viele andere Branchen. Alle profitieren direkt oder indirekt von einem Beibehalten des fossilen Status quo. Alternativ müssten sie für den Wandel zu Erneuerbaren enorme Summen investieren.
An diesem Punkt zeigt sich eine hässliche Seite des Kapitalismus‘: Wo derart viel Geld ist, da ist Macht nicht weit entfernt. Weltweit agieren deshalb bestens finanzierte Lobbygruppen. Sie
- üben Einfluss auf Regierende aus,
- steuern die öffentliche Meinung,
- streuen Desinformation und
- diskreditieren Umstrukturierungs- und Klimaschutzmaßnahmen.
Leider mit großem Erfolg. So waren etwa bei der 2024er UN-Klimakonferenz („COP 29“) fast 1.800 Lobbyisten der Kohle-, Öl- und Erdgas-Industrie zugegen. Im Jahr zuvor waren es sogar knapp 2.500 Personen – stabile drei Prozent der mehreren Zehntausend Teilnehmer.
Diese Macht ist riesig. Dementsprechend entwickelt sie eine enorme Bremskraft für den Kampf gegen den Klimawandel. Mittelfristig wird sich das erst ändern, wenn mit erneuerbaren Energien mehr Geld gemacht werden kann – wobei wir uns wenigstens dabei auf einem guten Weg befinden.
Fazit
Der Klimawandel wurde von vielen Akteuren über lange Zeiträume verursacht, wobei enorme Summen erwirtschaftet wurden und immer noch werden. Umgekehrt erfordert der Kampf dagegen ein gemeinsames Vorgehen in kurzer Zeit und mit riesigen Investitionen.
Es ist vor allem die Summe der Herausforderungen, welche die Bekämpfung so schwierig und aufwändig machen. Letztlich handelt es sich um das bislang größte Projekt der Menschheit – Schäden von Jahrhunderten beheben, bevor unumkehrbare Kipppunkte überschritten sind.
Da nicht weniger als die Bewohnbarkeit der Erde davon abhängt, ist das die größte denkbare Bewährungsprobe überhaupt. Ob wir sie bestehen, hängt von jedem einzelnen ab.